ECHO und AUFBRUCH VI
- Michael Krieger

- 27. Aug. 2025
- 4 Min. Lesezeit
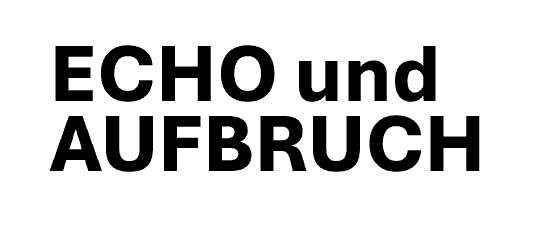
AUS DER PRAXIS
„Wo ist das Plakat zu den Alternativen?“
Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung zu einem geplanten Solarprojekt hatten wir einen Infomarkt aufgebaut: Themeninseln zu Genehmigungen, Umwelt, Technik und Bürgerbeteiligung. Ein klarer, transparenter Aufbau. Doch gleich zu Beginn der Vorstellung kam ein Bürger auf mich zu und sagte: „Hier fehlt ein fünftes Plakat – nämlich Alternativen.“
Ein klassischer Moment: Die Themeninseln sind auf das Projekt zugeschnitten, damit dort fokussiert diskutiert werden kann. Aber Bürgerinnen und Bürger bringen auch Fragen mit, die darüber hinausgehen – etwa nach der grundsätzlichen Energiewende-Strategie, nach Alternativen zur Flächennutzung oder schlicht nach ihrer eigenen Skepsis. Dafür braucht es einen Raum, der nicht im Fachdetail stecken bleibt.
Genau hier zeigt sich der Wert einer neutralen Moderation. Sie ist nicht Teil des Projektteams, wirkt glaubwürdiger bei Fragen „jenseits des Projekts“ und kann Unzufriedenheit auffangen, ohne dass sie sich im Sachgespräch an den Tischen festfrisst. Für viele Teilnehmende ist es eine Erleichterung, dass es jemanden gibt, der zuhört, den Faden aufnimmt und damit den Dialog weiterträgt – auch wenn er nicht in ein Plakat passt.
SEMINARE UND TERMINE
59-Minuten-Booster: Kommunikation statt Konfrontation in der Energiewende
In Bürgerdialogen, Gemeinderäten oder Projektgesprächen: Wenn’s um die Energiewende geht, sind Diskussionen oft hitzig. Fakten reichen dann nicht – gefragt sind Klarheit, Empathie und Deeskalation.
Genau hier setzt unser Online-Kurzseminar an. In nur 59 Minuten zeigen wir, wie Sie mit drei praxiserprobten Tools schwierige Gespräche souverän steuern – und aus Konfrontation wieder Kommunikation machen.
Termin: Mittwoch, 24. September 2025, 15:01-16:00 Uhr
Online, live & interaktivExakt 59 Minuten – kompakt, wirkungsvoll, auf den Punkt
Wer mit dabei sein will, kann einfach kurz auf diesen Newsletter antworten, dann schicken wir den Link.
DEUTSCH-FRANZÖSISCH
Deutsch-französische Konferenzen zur Energiewende – jetzt vormerken
Wir freuen uns, Ihnen zwei Veranstaltungen des Deutsch-Französischen Büros für die Energiewende (DFBEW) ankündigen zu dürfen, die relevant sind für Fachleute und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Forschung:
24. September 2025 in Paris – „Windenergie auf See: Ausschreibungsmodelle und Finanzierung in Deutschland und Frankreich“
Erfahren Sie, wie Deutschland und Frankreich ihre ambitionierten Ausbauziele (18 GW 🇫🇷 bis 2035, 30 GW 🇩🇪 bis 2030) durch innovative Ausschreibungs- und Finanzierungsansätze realisieren wollen. Expert:innen aus beiden Ländern diskutieren praxisnah den Ausbau der Offshore-Windenergie.
Mehr Informationen und Anmeldung: https://energie-fr-de.eu/de/veranstaltungen/leser/konferenz-windenergie-auf-see.html
19. November 2025 in Paris – „Agri-Photovoltaik in Deutschland und Frankreich: regulatorische und ökonomische Entwicklungen“
Wie kann die kombinierte Nutzung von Flächen für Landwirtschaft und Solarstromerzeugung erfolgreich gestaltet werden? Die Konferenz bietet spannende Einblicke in regulatorische und ökonomische Entwicklungen sowie Geschäftsmodelle für Agri-PV in Deutschland und Frankreich.
Mehr Informationen und Anmeldung: https://energie-fr-de.eu/de/veranstaltungen/leser/konferenz-zur-agri-photovoltaik-in-deutschland-und-frankreich.html
Beide Konferenzen werden zweisprachig (DE/FR) durchgeführt bieten eine ideale Plattform zum fachlichen Austausch und Netzwerken. Sie finden im französischen Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale Souveränität (MEFSIN) statt. Weitere Infos und Registrierungen unter www.dfbew.eu.
NARRATIV DES MONATS
„Es gibt doch Studien, die belegen, dass das alles gar nicht funktioniert.“
Diesen Satz hört man immer wieder – oft mit Nachdruck, selten mit Quelle. Ob es um Windkraft, Speicher, Netzstabilität oder Flächenverbrauch geht: Ein Verweis auf eine vermeintlich wissenschaftliche Autorität soll häufig genügen, um die Energiewende grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Dabei zeigt ein genauer Blick meist: Entweder gibt es die genannte Studie gar nicht, oder sie wurde falsch verstanden – oder sie ist methodisch schwach, interessengeleitet oder veraltet. Was bleibt, ist der rhetorische Effekt: Wissenschaft als Totschlagargument, ohne wissenschaftlich zu sein.
Gerade in Beteiligungsprozessen hat dieses Narrativ eine problematische Wirkung. Es verschiebt die Diskussion vom gemeinsamen Gestalten hin zu einem vermeintlich objektiven „Das geht sowieso nicht“. Wer mit Studien argumentiert, wirkt rational – auch wenn die Substanz fehlt. Deshalb lohnt sich Nachfragen: „Kennen Sie die Quelle? Mich interessiert, wie die Studie aufgebaut war.“ Oder: „Spannend, ich kenne einige Studien mit gegenteiligen Ergebnissen – vielleicht vergleichen wir mal die Annahmen dahinter.“ So entsteht nicht nur ein Dialog, sondern auch Raum für eine reflektierte Haltung zum Umgang mit Wissen – und zur Rolle, die wissenschaftliche Studien tatsächlich in politischen und planerischen Prozessen spielen (sollten).
Was hier hilft, sind positive Narrative, die nicht leugnen, dass Zukunft unsicher ist – sondern zeigen, dass Unsicherheit gestaltbar bleibt. Zum Beispiel: „Studien geben uns Orientierung. Aber Handeln verlangt Haltung.“ Oder: „Zukunft ist keine Extrapolation – sie ist das Ergebnis von Entscheidungen.“ Denn am Ende geht es bei der Energiewende nicht darum, ob es irgendeine Studie gibt, die Zweifel sät – sondern darum, ob wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt. Gemeinsam. Und mit dem Mut, Dinge auch dann zu tun, wenn sie (noch) nicht perfekt berechnet sind.
WERKZEUGKISTE
Präsenz zeigen – mit der „offenen Achse“
In hitzigen Diskussionen, schwierigen Veranstaltungen oder zähen Gremiensitzungen geht oft vergessen: Nicht nur was wir sagen wirkt – sondern auch wie wir da sind. Die „offene Achse“ ist ein einfaches Körpersprache-Prinzip für Beteiligungsprozesse: Stehen oder sitzen Sie so, dass Ihr Brustbein sichtbar bleibt, Ihre Schultern weich sind und Ihre Füße gleichmäßig am Boden stehen. Das klingt banal – aber es verändert spürbar die Wirkung: Du wirkst zugewandt, aber nicht unterwürfig. Standpunkt und Offenheit kommen ins Gleichgewicht. Die Körpersprache signalisiert: Ich bin hier. Ich halte aus. Ich höre zu. In der Moderation: bewusst aus dem „verkrampften Moderator:innen-Modus“ in die natürliche Standhaltung wechseln. In Konfliktsituationen: achte darauf, dich nicht unbewusst zurückzulehnen oder zu verschließen. Im Gespräch: auch im Sitzen hilft die offene Achse, Präsenz auszustrahlen – besonders bei hybriden Formaten.
Und wenn du dich fragst, ob du gerade in der offenen Achse bist: Mach kurz die Augen zu. Atme ein. Und frag dich: Bin ich gerade bei mir – oder bei der Abwehr?
KURZ & KLAR
„Die Akzeptanz der Energiewende entscheidet sich nicht im Koalitionsvertrag, sondern vor Ort.“
Katherina Reiche (zugeschrieben).

Kommentare