ECHO und AUFBRUCH - Ausgabe 7
- Michael Krieger

- 25. Sept. 2025
- 6 Min. Lesezeit
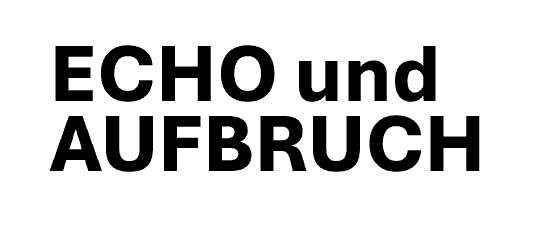
Willkommen zur siebten Ausgabe von „ECHO und AUFBRUCH“! Dieser Newsletter versammelt Gedanken, Methoden und Impulse rund um Kommunikation, Beteiligung und Projektentwicklung. Für alle, die Energiewende mit Haltung gestalten – und dafür gerne über das Offensichtliche hinausdenken.
Zwischen Zaudern und Zustimmung: Warum Kontrollverlust die Energiewende beschleunigen kann
Kontrollverlust. Ein Wort, das nach Chaos klingt. Nach Machtverlust. Nach einem Gefühl, das keiner gern spürt. Doch vielleicht ist genau dieser Kontrollverlust die wichtigste Ressource der Energiewende.
Stellen Sie sich einen Gemeinderat vor. Auf der Tagesordnung: ein Windpark. Der Projektentwickler hat alles vorbereitet, jede Zahl parat. Und dann? – Nichts. Man hört zu. Man bedankt sich. Man vertagt. Und vertagt wieder. Das ist kein böser Wille. Das ist Psychologie. Wer Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, entscheidet lieber gar nicht. Stillstand fühlt sich sicherer an als Risiko. So in einem Ort in Bayern. Sitzungen über Sitzungen, keine Entscheidung. Jahre verstreichen. Das Projekt? Blockiert.
Anderes Bild in Mecklenburg-Vorpommern. Der Projektentwickler kam nicht an die Fraktionen heran. Stattdessen Gerüchte: „Das dürfen nur die Stadtwerke machen.“ Die Stimmung: misstrauisch, verschlossen. Ich kam ins Spiel, sprach mit dem Bürgermeister, suchte Umwege. Am Ende sogar: ein Treffen mit der AfD-Fraktion. Absurde Gemengelage – und doch bewegte sich etwas. Und plötzlich: alle dafür. So sehr, dass ein Beteiligungsverfahren gar nicht mehr nötig war. Das Paradox: Erst völliges Zaudern – dann totale Zustimmung.
Widerstand ist oft nichts anderes als der Versuch, Kontrolle zurückzuholen. „Nein“ heißt selten „nie“. Meist heißt es: „Ich fühle mich überrollt.“ Im Gemeinderat sitzen keine Energiewende-Experten. Da sitzt die Landwirtin, der Autohändler, die Biologin, der Verwaltungsbeamte. Engagierte Menschen, aber fachfremd. Und plötzlich sollen sie entscheiden, ob ein Windpark mit 50 Megawatt gebaut wird. Ein Thema, so fremd wie die Frage: „Ab nächstem Jahr nur noch vegetarisches Essen in der Kita.“ Dafür? Dagegen? Enthaltung? Die meisten von uns sind keine Ernährungsexperten. Wir entscheiden nach Bauchgefühl, nach Ideologie, nach Gewohnheit. Genau so geht es Gemeinderäten bei Energiewendethemen. Dieses Unwohlsein, dieses Zögern – das ist Kontrollverlust.
Aber: Kontrollverlust kann auch beschleunigen. Denn wer die Illusion der totalen Kontrolle loslässt, öffnet sich für Neues. In Beteiligungsprozessen heißt das: zuhören statt verordnen, Verantwortung teilen statt abwehren, Vertrauen schaffen statt Misstrauen ernten. Das fühlt sich am Anfang chaotisch an. Doch es spart Jahre an Konflikten.
Beteiligung verlangsamt nicht. Es ist das Zaudern, das bremst. Beteiligung beschleunigt – wenn sie systemisch gedacht wird: Als echter Dialog. Als Übersetzung von Fachsprache in Alltagssprache. Als Brücke zwischen Experten und Bürgern.
Kontrollverlust ist nicht das Ende von Steuerung. Er ist der Anfang von Beteiligung. Zwischen Zaudern und Zustimmung entscheidet sich, ob wir die Energiewende schaffen. Und genau deshalb gilt:„Because it’s a fucking people’s business.“
Schweigen, das bewegt: Beobachtungen aus dem ersten Mute-&-Move-Pilotworkshop
Die meisten Workshops leben vom Austausch. Von Worten, von Diskussionen, von der Hoffnung, dass Reden schon irgendwie zur Lösung führt. Mute & Move dreht dieses Prinzip um. Hier wird bewusst geschwiegen – nicht als Entzug, sondern als Methode. Unser erster Pilotworkshop war ein Experiment. Wie reagieren Menschen auf erzwungene Ruhe? Was passiert, wenn Sprache als Steuerungsinstrument wegfällt? Welche neuen Dynamiken entstehen? Die Ergebnisse waren faszinierend, vielschichtig und stellen Gewohntes infrage. Hier teilen wir unsere Beobachtungen.
Die Regeln: Redeverbot als Rahmen | In einer zentralen Phase des Workshops galt ein klares Prinzip: keine verbale Kommunikation. Kein Flüstern, kein Kommentieren, keine verbalen Hinweise. Die Aufgabe war komplex, das Thema relevant – und doch durfte nicht gesprochen werden. Dieser Rahmen war für viele eine Zumutung. Und genau das war beabsichtigt.
Beobachtung 1: Der innere Widerstand | Schon nach wenigen Minuten war spürbar, wie schwer es vielen fiel, sich auf das Schweigen einzulassen. Eine Teilnehmerin rutschte sichtbar in eine Haltung der Ablehnung: genervt, die Arme verschränkt, irgendwann der Blick zur Tür. Null Bock. Keine Lust, Teil des Prozesses zu sein. Das Schweigen wurde als Kontrolle empfunden, als Einschränkung der eigenen Handlungsmacht. Und doch blieb sie. Irgendetwas hielt sie im Raum.
Beobachtung 2: Der verbissene Versuch, „funktional“ zu bleiben | Andere wiederum versuchten, das Schweigen zu überwinden, indem sie ihre gesamte Energie ins Tun legten. Sie arbeiteten hartnäckig weiter am Thema, klammerten sich an Aufgaben, versuchten mit Mimik, Gestik und Stift das zu kompensieren, was sonst durch Worte lief. Doch auch hier: Grenzen wurden spürbar. Die Tools aus dem „normalen“ Arbeitsalltag griffen nicht mehr. Verunsicherung machte sich breit.
Beobachtung 3: Spielerischer Ausbruch ins Kreative | Wieder andere ließen los. Sie begannen, zu zeichnen, zu basteln, sich spielerisch mit dem Material zu beschäftigen. Nicht alle blieben eng am Thema, aber sie blieben im Prozess. Diese Gruppe nutzte das Schweigen als Freiraum für neue Formen des Ausdrucks. Und plötzlich entstanden Bilder, Skizzen, kleine Objekte – Dinge, die im klassischen Workshopkontext keinen Platz gehabt hätten. Die Kreativität kam nicht trotz der Stille, sondern durch sie.
Beobachtung 4: Mikro-Dynamiken zwischen den Gruppen | Besonders spannend war das, was zwischen den Menschen geschah. Auch ohne Worte bildeten sich kleine Gruppen: die Frustrierten, die Fokussierten, die Spielerischen. Aber diese Gruppen waren nicht stabil. Einzelne wechselten die Seiten. Es gab Blicke, Bewegungen, kleine Gesten, die zur Überbrückung einluden. Und immer wieder auch: Momente der Annäherung. Die Stimmung war dynamisch, fast lebendig in der Bewegungslosigkeit.
Beobachtung 5: Der stille Transfer | Was uns am meisten beeindruckte: Trotz aller Unterschiedlichkeit entstand ein kollektiver Prozess. Keine Gruppe blieb dauerhaft in ihrer „Zone“. Die Genervten ließen sich irgendwann doch auf eine kleine Handlung ein. Die Spielerischen fanden zurück zum Thema. Die Verbissenen lockerten sich. Es war, als würden Impulse unbemerkt durch den Raum wandern. Nicht gerichtet, nicht gesteuert. Aber wirksam.
Und dann: Rückkehr zur Aufgabe | Nach der Schweigephase war kein „Restart“ nötig. Niemand musste neu motiviert werden. Alle fanden zur Aufgabe zurück. Nicht, weil sie mussten. Sondern weil sie sich dem Prozess verpflichtet fühlten. Die Stille hatte etwas in Gang gesetzt, das Worte zuvor nicht erreicht hätten: eine kollektive Verantwortung.
Was wir gelernt haben | Schweigen ist kein Defizit, sondern eine Ressource. Unterschiedliche Reaktionen auf Stille sind normal – und wertvoll. In der Stille entstehen neue Kommunikationsformen. Gruppendynamiken funktionieren auch ohne Sprache. Kreative Prozesse brauchen manchmal weniger Input, nicht mehr.
Was wir daraus machen | Mute & Move bleibt ein Experiment – aber eines mit Richtung. Die nächsten Workshops werden weiter erforschen, wie Schweigen, Bewegung und Gruppenprozesse zusammenspielen. Wir sind überzeugt: Wenn wir lernen, mit Schweigen zu arbeiten, statt es zu fürchten, entstehen neue Räume für Zusammenarbeit, Kreativität und echtes Verstehen.
Lust, das selbst zu erleben? Wir freuen uns über Anfragen, Interesse und Mitstreiter. Vielleicht schweigen wir ja bald gemeinsam – und kommen dabei weiter, als manch langer Workshop-Tag je geführt hat.
Die Kunst der Moderation: Warum wir mehr brauchen als gute Gespräche
Ein Workshop mit engagierten Teilnehmenden, ein komplexes Thema – und plötzlich steht alles still. Einer spricht zu viel, eine andere ist genervt, zwei klinken sich aus. Die Energie kippt. Und alle blicken zur Moderation. Was jetzt?
In Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung, hoher Erwartungen an Beteiligung und wachsender Komplexität in Organisationen reicht es nicht mehr, „ein bisschen durch den Tag zu führen“. Moderation ist längst zur Schlüsselkompetenz geworden: für Führungskräfte, Projektleitende, Prozessbegleiter:innen – und alle, die Verantwortung für Dialoge übernehmen. Doch was bedeutet gute Moderation wirklich?
Gute Moderation beginnt nicht mit einem Flipchart. Sie beginnt mit der Haltung: Kann ich zuhören – auch wenn es laut wird? Kann ich führen – ohne zu dominieren? Kann ich Räume schaffen – in denen Menschen sich zeigen, ohne sich zu verlieren? Natürlich braucht es auch Methoden. Struktur. Visualisierung. Klarheit. Doch die entscheidende Fähigkeit ist: Menschen und Prozesse so zu steuern, dass Vertrauen, Beteiligung und Ergebnisse wachsen – gleichzeitig.
Genau darum geht es in unserem Seminar: Die Kunst der Moderation. Am Samstag, 8. November 2025 lade ich Euch nach Berlin ein – zu einem intensiven Moderationstraining mit Herz, Verstand und Werkzeugkasten. Ob Du Einsteiger:in bist oder bereits Erfahrung hast – Du wirst gestärkt, geschärft und inspiriert nach Hause gehen.
Warte nicht, bis es wieder knirscht. Lerne, wie Du Gruppen wirklich führen kannst – mit Klarheit, Haltung und echter Präsenz. Bei Interesse einfach auf diese Email antworten. Ich freue mich auf Dich.
Essay: Die geschlossene Welt – Warum der Nihilismus keine Sprache mehr findet
Etwas ist zu Ende gegangen – leise, fast unmerklich. Lange hat der Nihilismus unsere Kultur bestimmt: in Literatur, Kunst, Politik, ja sogar in der Art, wie wir uns selbst verstanden haben. Doch heute verliert er seinen Resonanzraum. Serien erzählen endlos dieselben Geschichten, politische Debatten verengen sich auf Freund-Feind-Schemata, und die großen Fragen scheinen verstummt.
In meinem neuen Essay „Die geschlossene Welt – Warum der Nihilismus keine Sprache mehr findet“ beschreibe ich diesen Umbruch. Es ist kein Text über abstrakte Theorien, sondern über unsere Gegenwart: über das Gefühl, dass die Welt immer komplexer wird – und gleichzeitig einfacher klingen soll. Über den Rückzug in Gewissheiten. Über die Angst, dass Offenheit keine Kraft mehr hat.
Dabei gehe ich von Beobachtungen aus, die ich seit vielen Jahren mache – in gesellschaftlichen Konflikten, politischen Diskursen und kulturellen Räumen. Die Energiewende etwa wirkt wie ein Brennglas: Hier wird verhandelt, wie wir leben wollen, wer gehört wird und was verschwindet. Diese Erfahrungen fließen in den Essay ein und machen ihn zu einer sehr persönlichen Zeitdiagnose.
„Die geschlossene Welt“ ist eine Einladung, das Schweigen nicht als Ende zu verstehen, sondern als Möglichkeit für einen neuen Anfang. Wer Lust hat, sich mit mir auf diesen Gedankenweg einzulassen, kann den Essay hier lesen.

Kommentare